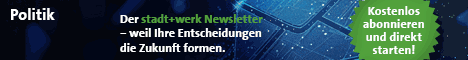MeldorfGrube als Wärmespeicher
Mehr als die Hälfte des Energieverbrauchs in Deutschland geht auf das Heizen von Gebäuden und die Wärmeversorgung der Wirtschaft zurück. Kommunen, die einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und Emissionen einsparen möchten, sollten Fernwärme in ihre Energiestrategie integrieren. Wie dies erfolgreich umgesetzt wird, zeigt Meldorf in Schleswig-Holstein: Dort entstehen derzeit mithilfe des dänischen Beratungsunternehmens Ramboll ein Wärmenetz sowie Deutschlands erster Erdbeckenwärmespeicher.
„Das Ziel ist klar: Mit dem Projekt wollen wir unseren Beitrag zur Energiewende leisten. Es ist bekannt, dass ein Großteil der in Deutschland benötigten Energie für die Wärmeversorgung aufgewendet wird. Die ohnehin anfallende Wärme zu nutzen, erscheint mir vor diesem Hintergrund nur logisch“, sagt Rolf Claußen, Geschäftsführer der WIMeG Wärme Infrastruktur Meldorf, und ergänzt: „Künftig werden dann in Meldorf über 50 Gebäude mit klimafreundlicher Fernwärme versorgt. Darunter auch öffentliche Liegenschaften wie Schulen, das Schwimmbad, Sporthallen und das Landesmuseum.“
Abwärme aus Druckerei
In Meldorf entsteht in einer Druckerei industrielle Abwärme. Die Abwärme der Druckmaschinen wird in Zukunft entweder direkt in das Wärmenetz eingespeist oder bei einem Überangebot in den Wärmespeicher geleitet. Als Speichermedium wird Wasser verwendet, wie auch im Wärmenetz selbst. Das Wärmenetz funktioniert, indem die Wärme zum Aufheizen von Wasser genutzt wird. Dieses wird dann über Rohre direkt in die Gebäude geleitet und als Heizenergie oder Heißwasser eingesetzt. Zusätzlicher Bedarf kann über eine Biogas-Blockheizkraftwerk-Anlage abgedeckt werden, die erneuerbare Energie erzeugt. In einer späteren Phase soll zudem das Wärmeangebot durch den Betrieb von Solarthermieanlagen erweitert werden.
In dem rund 45.000 Kubikmeter großen Wärmespeicher in Meldorf wird ab 2022 die im Sommer anfallende Wärme zwischengespeichert. Steigt der Wärmebedarf im Winter, kann sie verfügbar gemacht werden. Der Wärmespeicher nimmt in der Energiestrategie für Meldorf eine wichtige Rolle ein: „Der Speicher ermöglicht eine Verlagerung der Verfügbarkeit von Wärmeenergie in die kalten Jahreszeiten. So können wir überschüssige Energie im Kreislauf halten und reduzieren Emissionen. Denn durch die Speicherung muss weniger Wärme auf Basis fossiler Brennstoffe erzeugt werden“, erklärt Stefan Maretzki, Projektleiter beim Unternehmen Ramboll.
Größter Wärmespeicher der Welt
Ramboll betreut den Aus- und Neubau des Wärmenetzes und den Bau des saisonalen Speichers. Die ursprünglich aus Dänemark stammende Firma hat mittlerweile fast 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland und war maßgeblich an der Entwicklung von Erdbeckenwärmespeichern beteiligt. Seit der ersten Anlage dieser Art im Jahr 2010 hat Ramboll den bislang größten Wärmespeicher der Welt im dänischen Vojens entworfen sowie eines der größten Wärmesysteme weltweit in Kopenhagen geplant, welches eine Million Bürger mit Wärme versorgt.
„Mit Ramboll haben wir einen verlässlichen Partner in unserer Innovationspartnerschaft Erdbeckenwärmespeicher, die das Vorhaben umsetzen wird. Ramboll hat durch die Erfahrung in ähnlichen Projekten ein Alleinstellungsmerkmal und kann uns kompetent in allen Leistungsphasen unterstützen“, sagt Peter Bielenberg von der EnergieManufaktur Nord Partnerschaftsgesellschaft (EMN). Bielenberg hat die Wärmewende in Meldorf angestoßen und ist maßgeblich an der Entwicklung der Projektidee beteiligt.
Baustoff Boden
Für den Bau des Speichers wurde eine bislang landwirtschaftlich genutzte Fläche umgewidmet. Druckerei, Speicher und Biogasanlage liegen in direkter Nachbarschaft zueinander, was einen effizienten Betrieb der Gesamtanlage ermöglicht. Der Wärmespeicher wird durch die Herstellung einer großen geböschten Baugrube realisiert. Der wesentliche Baustoff ist der Boden, der bereits vor Ort vorhanden ist. Der Einsatz emissionsintensiver Baustoffe wird somit auf ein Minimum reduziert. Das entstandene Erdbecken wird durch langlebige und temperaturresistente Dichtungsbahnen ausgekleidet, damit das Speicherwasser nicht versickern kann. Nach oben hin wird der Speicher mit einer Schwimmabdeckung (Floating Cover) versehen, die sowohl eine Schutz- als auch eine Dämmwirkung hat.
„Die Planung des Floating Covers stellt wohl die größte technische Herausforderung beim Bau des Speichers dar, da sie mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erfüllen hat“, sagt Stefan Maretzki. Auch Starkregenereignisse, die aufgrund des Klimawandels häufiger werden könnten, müssen in den Planungen berücksichtigt werden – immerhin nimmt die Schwimmabdeckung eine Fläche von fast einem Hektar ein.
Vernetztes Planen
Rambolls Ingenieure bearbeiten sämtliche für die Umsetzung relevanten Themen. Sie setzen bei der Verwirklichung auf vernetztes Planen. Denn der zeitliche Rahmen für das vom Projektträger Jülich (PtJ) geförderte Projekt ist eng. „Durch die Zeitvorgabe ist eine hochgradig effiziente und zielstrebige Planung umso wichtiger. Wir nehmen also eine moderierende und koordinierende Rolle zwischen allen Projektpartnern ein. Denn nur wenn alle relevanten Akteure frühzeitig ins Boot geholt werden, kann ein solch ambitioniertes Projekt in so kurzer Zeit umgesetzt werden“, erklärt Maretzki.
Er ist überzeugt, dass Behörden, Träger öffentlicher Belange, Lieferanten, Baufirmen und weitere Akteure in den aktiven Austausch einbezogen werden müssen: „Wir agieren auf Augenhöhe und erarbeiten Hand in Hand die optimale Lösung. Das geht nur mit den richtigen Strukturen. Kommunen müssen weg vom Silo-Denken. Projektabläufe stocken dann, wenn es den Projektleitern nicht gelingt, Brücken zwischen den unterschiedlichen Verantwortlichen zu schlagen und so reibungslose Abläufe zu ermöglichen.“ In Meldorf wurde eigens eine Innovationspartnerschaft nach §19 der Vergabeverordnung ins Leben gerufen. Das erleichtert den Wissenstransfer zwischen den unterschiedlichen Beteiligten enorm. Außerdem sorgen klare Projektphasen und sinnvoll abgestimmte Arbeitspakete dafür, dass Meldorfs Wärmewende ein Erfolg wird.
Klimaschonende Kommunen
Kommunen sind für den Schutz unseres Klimas zentral, die Anreize dafür müssen aber auf Landes- und Bundesebene gegeben werden. Denn die Wärmewende ist für den Erfolg der Energiewende unabdingbar. Das Wärmenetz sorgt bei der richtigen Ausgestaltung für eine klimaverträgliche Versorgung von Wohnhäusern, Schulen und Kindergärten, Gewerbeimmobilien und der Industrie. Zentrale Ansätze sind die Speisung aus industrieller Abwärme und erneuerbaren Energien. „Fernwärme ist für Deutschland so interessant, weil sie sich perfekt in das System der erneuerbaren Energien einfügt“, sagt Maretzki und ergänzt: „In Meldorf zeigt sich, dass Kommunen mit den richtigen Anreizen und Förderprogrammen innovative Projekte zum Erfolg führen können. Hier entsteht derzeit ein Projekt, das Vorbildcharakter für Städte und Gemeinden in ganz Deutschland haben kann.“
https://de.ramboll.com
Dieser Beitrag ist in der Ausgabe Januar/Februar 2022 von stadt+werk erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.
Ratingen: Batteriespeicher angeschlossen
[05.01.2026] Quantum hat in Ratingen einen Batteriespeicher mit 2,5 Megawatt Leistung an das Mittelspannungsnetz angeschlossen. Das Projekt soll kleineren und mittleren Stadtwerken Dienstleistungen rund um Speicher und Flexibilisierung ermöglichen. mehr...
Interview: Schlüssel für die Energiewende
[22.12.2025] Gemeinsam mit Stadtwerken realisiert Verbund Energy4Business Germany, Vertriebstochter des Unternehmens Verbund, Großbatteriespeicherprojekte. Im Interview erläutert Geschäftsführer Thomas Bächle, warum Batteriespeicher ein zentrales Element der Energiewende sind. mehr...
FFB PreFab: Erste Batterie vom Band gelaufen
[22.12.2025] In Münster ist erstmals eine elektrisch funktionsfähige Lithium-Ionen-Batteriezelle aus der Forschungsfabrik FFB PreFab entstanden. Die Anlage bildet eine vollständige europäische Prozesskette von der Elektrodenfertigung bis zur geladenen Zelle ab und gilt als wichtiger Schritt für Batterien aus Deutschland. mehr...
Kreis Freising: Floor-Vertrag für Batteriespeicher abgeschlossen
[18.12.2025] Ein Floor-Vertrag zwischen MVV Trading und der Bürger Energie Genossenschaft Freisinger Land soll die Wirtschaftlichkeit eines neuen Batteriespeichers sichern. Das Konzept verbindet eine garantierte Mindestvergütung mit der flexiblen Vermarktung an Strom- und Regelenergiemärkten. mehr...
SWLB: Stromspeicher in Planung
[16.12.2025] In Ludwigsburg entsteht ab 2026 ein Stromspeicher mit 1,3 Megawatt Leistung und fünf Megawattstunden Kapazität. Das Projekt der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim soll erneuerbare Energien besser ins Netz integrieren und neue Flexibilitätsoptionen erschließen. mehr...
Second-Life-Batterien: Innovation trifft Ressourceneffizienz
[15.12.2025] E-Auto-Batterien landen oft im Recycling, obwohl sie noch einen Großteil ihrer ursprünglichen Speicherkapazität besitzen. Im Projekt UniSTA zeigen Uniper und STABL Energy, wie sich solche Second-Life-Batterien als Alternative zu neuen Speichersystemen nutzen lassen. mehr...
Energiespeicherung: Batteriespeicher erleben Boom
[08.12.2025] Batteriespeicher sind ein wichtiges Element der Energiewende, denn sie gleichen Produktions- und Nachfrageschwankungen aus. Deutschland muss schnell rechtssichere und vor allem bundesweit einheitliche Regelungen schaffen, um das Potenzial voll ausschöpfen zu können. mehr...
Zeithain: Baustart von Solar-Batterie-Kombiprojekt
[18.11.2025] In Zeithain entsteht ein Kombiprojekt aus Solarfeld und Batteriespeicher, das den intelligenten Ausbau erneuerbarer Energien demonstrieren soll. SachsenEnergie meldet den Start der Bauarbeiten für eine 20-Megawatt-PV-Anlage, die später um einen leistungsstarken Speicher ergänzt werden soll. mehr...
Staßfurt: Großspeicher entsteht
[10.11.2025] In Förderstedt bei Staßfurt entsteht ein groß dimensionierter Batteriespeicher mit 300 Megawatt Leistung und mehr als 700 Megawattstunden Speicherkapazität. Nach Angaben von Eco Stor soll die privat finanzierte Anlage das Stromnetz stabilisieren und in Zeiten schwankender Einspeisung aus erneuerbaren Energien bis zu 500.000 Haushalte zwei Stunden lang versorgen können. mehr...
Gundremmingen: Bau des größten Batteriespeichers Deutschlands
[07.11.2025] RWE baut in Gundremmingen den bislang größten Batteriespeicher Deutschlands. Die Anlage mit 400 Megawatt Leistung soll 2028 in Betrieb gehen und rund 230 Millionen Euro kosten. mehr...
Röhrsdorf: LichtBlick baut Großbatteriespeicher
[29.10.2025] In Röhrsdorf bei Chemnitz startet der Bau des ersten Großbatteriespeichers von LichtBlick. Die 100-Millionen-Euro-Investition soll ab 2027 mit 100 Megawatt Leistung und vier Stunden Speichertiefe einen wichtigen Beitrag zur Netzstabilität leisten. mehr...
Crottendorf: Bau eines Großbatteriespeichers
[23.10.2025] In Crottendorf im Erzgebirge soll noch 2025 der Bau eines Großbatteriespeichers beginnen. Das Projekt des Hamburger Unternehmens Big Battery Deutschland hat die Baureife erreicht und soll künftig 15 Megawatt Leistung und 30 Megawattstunden Speicherkapazität bereitstellen. mehr...
Föhren: Großbatteriespeicher eingeweiht
[17.10.2025] In Föhren bei Trier ist einer der ersten Großbatteriespeicher im europäischen Verteilnetz offiziell in Betrieb gegangen. Das System soll zeigen, wie Speicher und Wechselrichter künftig zur Netzstabilität beitragen und die Energiewende technisch absichern können. mehr...
Positionspapier: Speicher besser einbinden
[16.10.2025] Der Bundesverband Windenergie und der Bundesverband Energiespeicher Systeme wollen, dass der kombinierte Ausbau von Erneuerbaren und Speichern gezielt gefördert wird. Das soll Kosten senken, Versorgung sichern und Bürokratie abbauen. mehr...
Hertener Stadtwerke: Zechengelände erhält Großbatteriespeicher
[15.10.2025] Die Hertener Stadtwerke errichten auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Ewald einen Batteriegroßspeicher mit einer Kapazität von über 20 Megawattstunden. Die Anlage soll ab Februar 2027 Strom ins Netz einspeisen und so zur Stabilisierung der regionalen Energieversorgung beitragen. mehr...