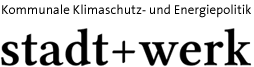Smart City:
Verbinden, was zusammengehört
[12.10.2022] In Wolfsburg haben die Stadtwerke eine herstellerunabhängige Datenplattform für die Smart City entwickelt. Diese beeinträchtigt die bisherige Datenverarbeitung in Silos nicht, sondern stellt eine zusätzliche Möglichkeit dar, die Daten handlungsfeldübergreifend zu analysieren.
 Mit der Initiative #WolfsburgDigital wurde die Grundlage für die Digitalisierung in der niedersächsischen Stadt geschaffen. Es entstand ein Reallabor für digitale Dienstleistungen, Technologien und neue Geschäftsfelder – mit dem Grundgedanken, die Digitalisierung strategisch im Sinne einer integrierten nachhaltigen Stadtentwicklung zu gestalten. Damals wie heute ging es darum, durch die Nutzung von digitalen Prozessen und Dienstleistungen konkrete Mehrwerte für Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Smarte Anwendungen also, die das tägliche Leben erleichtern sollen, etwa durch vernetzte Mobilitätsservices, verbessertes Energie-Management, nutzerzentrierte Verwaltungsleistungen oder digitale Bildung.
Mit der Initiative #WolfsburgDigital wurde die Grundlage für die Digitalisierung in der niedersächsischen Stadt geschaffen. Es entstand ein Reallabor für digitale Dienstleistungen, Technologien und neue Geschäftsfelder – mit dem Grundgedanken, die Digitalisierung strategisch im Sinne einer integrierten nachhaltigen Stadtentwicklung zu gestalten. Damals wie heute ging es darum, durch die Nutzung von digitalen Prozessen und Dienstleistungen konkrete Mehrwerte für Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Smarte Anwendungen also, die das tägliche Leben erleichtern sollen, etwa durch vernetzte Mobilitätsservices, verbessertes Energie-Management, nutzerzentrierte Verwaltungsleistungen oder digitale Bildung.Der Weg von der analogen zur digitalen Stadt ist vergleichbar mit einem Marathonlauf. Zwar gibt es in einer Stadt unzählige Objekte, doch sind diese in der Regel stumm. Sie senden keine Daten über ihren Zustand. Die Stadtverwaltung Wolfsburg hat schnell die Notwendigkeit einer modernen IT- und Kommunikationsinfrastruktur erkannt. Deren Aufbau wurde als zentrale Aufgabe bei den Stadtwerken und ihrer Tochter WOBCOM angesiedelt. Der zentrale Infrastrukturdienstleister hat die Digitalisierung von jeher als Werkzeug verstanden, das, richtig eingesetzt, Prozesse vereinfachen und die Lebensbedingungen der Menschen in einer Stadt verbessern kann.
Objekte liefern wertvolle Informationen
In den vergangenen Jahren wurde daher gezielt in Internet-of-Things(IoT)-Sensoren, Konnektivität und Dateninfrastruktur investiert. Mittlerweile liefern immer mehr Objekte im gesamten Stadtgebiet wertvolle Informationen. Die Liste der Anwendungsfälle ist lang: Papiercontainer, die den Entsorgungsunternehmen melden, wie voll sie sind und somit zur Optimierung der Leerungsrouten beitragen oder smarte Park-Management-Lösungen, die freie Parkplätze in einer Tiefgarage oder den Belegungszustand von Ladestationen im Stadtgebiet anzeigen. Möglich machen dies verschiedene Sensoren, die Datenpakete je nach Anwendungsfall über feste und drahtlose Netzwerke senden. Bei der Umsetzung und Einführung von IoT-Lösungen haben die beiden kommunalen Unternehmen immer auch die Wirtschaftlichkeit im Blick. So ist der Einsatz von batteriebetriebenen Sensoren zur Parkraumüberwachung in einer gut ausgestatteten Tiefgarage mit Stromversorgung in der Regel unwirtschaftlich, zusätzlich wird die Umwelt belastet. Auf der anderen Seite kann der Einsatz von Sensoren mit Batterien im Bereich der Füllstandsüberwachung effizienter und nachhaltiger sein. Die Sensorikauswahl sollte stets mit Weitblick erfolgen und Fragen nach der vorhandenen Stromversorgung und den Zeitintervallen, in denen die Daten benötigt werden, beantworten. Bevor WOBCOM eine digitale Lösung entwickelt, werden immer erst die Gegebenheiten vor Ort analysiert.
Das Gehirn der Smart City
Zur Speicherung und Analyse und damit die Daten auch tatsächlich zwischen den Akteuren fließen sowie neue Anwendungsfälle geschaffen werden, haben Stadtwerke und WOBCOM die Offene Digitale Plattform (ODP) entwickelt, eine eigene urbane Datenplattformlösung. Die Infrastruktur betrachten die Stadtwerke und ihre Tochter zunächst einmal neutral. Dies ermöglicht es, die beste Lösung für jeden Anwendungsfall zu finden – herstellerunabhängig und technologieoffen. Die Grundidee dabei ist, Informationen aus unterschiedlichen Datensilos, die alle ihre Berechtigung haben, als kontextbezogene Informationen automatisiert zu erfassen und in entsprechende konsolidierte, wiederverwendbare und übertragbare Datenmodelle zu bringen. Für die Weiterverarbeitung über zentrale APIs stehen unterschiedlichste Informationen zur Verfügung, etwa Verbrauchs- und Umweltdaten, Verkehrsinformationen oder verwaltungsspezifische Daten – sowohl in der Plattform als auch außerhalb.
Um an die Daten zu gelangen, wurde zunächst analysiert, welche Informationen in der Stadt als Open Data vorliegen. Das sind in der Praxis gar nicht so viele und meist eher statische oder historische Daten. Die Herausforderung bestand darin, verschiedene Themen zusammenzubringen, also jene Informationen, die in getrennten Silos verschlossen vorliegen. Anstatt die bisherige Verarbeitung der Daten in Silos zu beeinträchtigen oder eine Alternative anzubieten, stellt die Plattform eine zusätzliche Möglichkeit dar, die Daten handlungsfeldübergreifend zu analysieren. So liegen beispielsweise zwar statische Informationen zum Ort einer Ladesäule vor, allerdings in unterschiedlichen Formaten und Qualitäten. Auch existieren unterschiedliche Schreibweisen bei den Ladetypen der Säulen. In Verbindung mit anderen Informationen werden die Zugriffe und das Datenmodell so weit wie möglich validiert und standardisiert, um potenzielle Mehrwerte und Optimierungen umzusetzen – sogar in bisher undenkbaren Anwendungsfällen.
Besonderheit des Wolfsburger Ansatzes
Was den Wolfsburger Ansatz besonders macht: Er will zu einem Standard beitragen, der auch in anderen Kommunen funktioniert. Anstatt sich auf einen Hersteller mit spezieller Sensorik und Produkten festzulegen, waren die Wolfsburger bei der Entwicklung von konkreten Anwendungen völlig frei. Es konnten verschiedene Sensoren erprobt und nach dem Kosten-Nutzen-Vergleich die bestmögliche technische Lösung eingesetzt werden. Stadtwerke und WOBCOM haben außerdem darauf geachtet, nur solche Partner für die Offene Digitale Plattform auszuwählen, die sich im Sinne einer Open-Source-Kultur bereit erklären, grundsätzlich technologieoffen und nutzerorientiert zusammenzuarbeiten. Daher spielt auch die in Berlin ansässige FIWARE Foundation bei der Architektur der Plattform eine wichtige Rolle.
Ohne Daten lassen sich keine Anwendungen realisieren, auch nicht mit künstlicher Intelligenz. Stadtwerke und WOBCOM haben inzwischen ein Datenfundament aufgebaut, das es beiden Unternehmen erlaubt, andere Partner ins Boot zu holen, damit auch große Analysen gemacht werden können. Mithilfe von Technologien unter anderem von Dell Technologies und Nvidia planen, implementieren und optimieren die Experten der Stadtwerke Lösungen und Infrastrukturen, mit denen der Wert der Daten immer effizienter ausgeschöpft werden kann. Technologien wie künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen unterstützen Big-Data- und IoT-Analysen, um verwertbare Erkenntnisse und Ergebnisse für Kunden, Vorgänge und Produkte zu gewinnen. Im Ergebnis ist eine einmalige Infrastruktur entstanden, die es ermöglicht, technologie- und ortsunabhängig Daten von Stadt, Industrie und Wirtschaft auf einem neutralen Boden in den Kontext zu setzen.
Microservices-Architektur
Die Offene Digitale Plattform basiert auf einer Microservices-Architektur. Diese ist hoch modular aufgebaut; einzelne Services laufen in einem oder mehreren Containern, die auf einer gemanagten Kubernetes-Plattform im WOBCOM-Rechenzentrum betrieben werden. Daraus ergeben sich hinsichtlich Skalierbarkeit, Deployment und Betrieb einer Vielzahl von Services zahlreiche Vorteile. Die Basis bildet die IoT-Devices-Schicht: Dort entstehen die Daten verteilt über die ganze Stadt oder Industriestandorte. In der Kommunikationsschicht werden diese Informationen zur Verarbeitung an die Datenplattform verschlüsselt übertragen, beispielsweise über LoRaWAN, Glasfaser, WLAN oder LTE. Aggregierte und valide Informationen werden anschließend in der Nutzungsschicht für unterschiedliche User über abgesicherte Endpunkte zur Verfügung gestellt. Das können zum Beispiel eine Stadt-App oder ein Dashboard für die Verwaltung und das Abfall-Management sein. Zusätzlich können die Informationen als API für weitere Analysen und die Entwicklung von Anwendungsfällen bereitgestellt werden.
Anatoli Seliwanow
Der Autor, Anatoli Seliwanow
Diplom-Ingenieur Anatoli Seliwanow verantwortet die Bereiche Infrastruktur, Datacenter und Software-Entwicklung bei der WOBCOM GmbH, einer Tochtergesellschaft der Stadtwerke Wolfsburg AG. Er ist federführend bei den Themen Internet of Things (IoT) und Datenplattform.
Diplom-Ingenieur Anatoli Seliwanow verantwortet die Bereiche Infrastruktur, Datacenter und Software-Entwicklung bei der WOBCOM GmbH, einer Tochtergesellschaft der Stadtwerke Wolfsburg AG. Er ist federführend bei den Themen Internet of Things (IoT) und Datenplattform.
https://stadtwerke-wolfsburg.de
https://www.wobcom.de
Dieser Beitrag ist in der Ausgabe September/Oktober 2022 von stadt+werk erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren. (Deep Link)
Stichwörter: Smart City, Stadtwerke Wolfsburg, #WolfsburgDigital, IoT, WOBCOM, Microservices-Architektur
Bildquelle: Siarhei/stock.adobe.com
Weitere Meldungen und Beiträge aus dem Bereich Smart City
Kreis Mayen-Koblenz: LoRaWAN-Antenne installiert
[27.6.2024] Auf dem Dach des CJD-Berufsförderungswerks in Vallendar ist jetzt eine LoRaWAN-Antenne installiert – sie ist ein wichtiger Baustein des Projekts „Smarte Region MYK10“. mehr...
[27.6.2024] Auf dem Dach des CJD-Berufsförderungswerks in Vallendar ist jetzt eine LoRaWAN-Antenne installiert – sie ist ein wichtiger Baustein des Projekts „Smarte Region MYK10“. mehr...
Aachen: Start eines LoRaWAN-Projekts
[24.6.2024] Im Netz der StädteRegion Aachen soll jetzt in einem Gemeinschaftsprojekt von Regionetz, NetAachen und regio iT bis Ende 2025 ein leistungsfähiges, innovatives Kommunikationsnetzwerk aufgebaut werden, um alle netzdienlichen Anwendungsfälle von Regionetz innerhalb des Netzgebiets abzudecken. mehr...
[24.6.2024] Im Netz der StädteRegion Aachen soll jetzt in einem Gemeinschaftsprojekt von Regionetz, NetAachen und regio iT bis Ende 2025 ein leistungsfähiges, innovatives Kommunikationsnetzwerk aufgebaut werden, um alle netzdienlichen Anwendungsfälle von Regionetz innerhalb des Netzgebiets abzudecken. mehr...
Würzburg: Erste 5G-Straßenleuchte Bayerns
[22.4.2024] In Würzburg wurde jetzt die erste 5G-Straßenleuchte Bayerns in Betrieb genommen. Sie ist das Ergebnis eines Pilotprojekts von O2 Telefónica, 5G Synergiewerk und den Stadtwerken Würzburg. mehr...
[22.4.2024] In Würzburg wurde jetzt die erste 5G-Straßenleuchte Bayerns in Betrieb genommen. Sie ist das Ergebnis eines Pilotprojekts von O2 Telefónica, 5G Synergiewerk und den Stadtwerken Würzburg. mehr...
Hagen: Erfassung des Energieverbrauchs
[11.4.2024] In der Stadt Hagen erfassen intelligente Messsysteme und Sensoren seit Anfang Februar den Energieverbrauch in städtischen Gebäuden. mehr...
[11.4.2024] In der Stadt Hagen erfassen intelligente Messsysteme und Sensoren seit Anfang Februar den Energieverbrauch in städtischen Gebäuden. mehr...
Konstanz: Wetterstationen für die Smart Green City
[22.12.2023] Zwölf Wetterstationen liefern in Konstanz künftig genaue Klimadaten. Diese sollen unter anderem für die Stadtplanung und zur effizienten Steuerung des Winterdienstes genutzt werden. mehr...
[22.12.2023] Zwölf Wetterstationen liefern in Konstanz künftig genaue Klimadaten. Diese sollen unter anderem für die Stadtplanung und zur effizienten Steuerung des Winterdienstes genutzt werden. mehr...