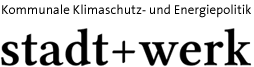Power to Gas:
Wesentliche Brücke
[20.5.2020] Wenn Erneuerbare zur tragenden Säule der Energieversorgung werden, ist es erforderlich, große Energiemengen über längere Zeiträume zu speichern. Hierbei spielt die Power-to-Gas-Technologie eine zentrale Rolle.
 Zukünftig wird die Erzeugung elektrischer Energie in Wind- und Solaranlagen zur tragenden Säule der Energieversorgung. Zwar können sowohl mechanische und elektrische Energie als auch Wärme direkt aus elektrischer Energie gewonnen werden, allerdings erzeugen Wind- und Solaranlagen Energie nicht bedarfsgerecht, sondern aufkommensabhängig. Zur Anpassung der Erzeugung an die Nachfrage sind neben Flexibilisierungsinstrumenten auf der Verbraucherseite, dem so genannten Demand Management, auch Verfahren erforderlich, die Energiemengen in der Größenordnung von Terawattstunden über längere Zeiträume speichern können. Dies ist nur über die Umwandlung elektrischer Energie in chemische Energieträger möglich – die Power-to-Gas-Technologie (PtG) ist die wesentliche Brücke zwischen der Erzeugung erneuerbarer Energie in Wind- und Solaranlagen und deren umfassender Nutzung im Energiesystem. Dabei wird elektrische Energie mithilfe der Elektrolyse in Wasserstoff umgewandelt. Aus diesem können bei Bedarf durch nachfolgende Synthese beispielsweise auch Methan oder flüssige Energieträger beziehungsweise Chemikalien erzeugt werden.
Zukünftig wird die Erzeugung elektrischer Energie in Wind- und Solaranlagen zur tragenden Säule der Energieversorgung. Zwar können sowohl mechanische und elektrische Energie als auch Wärme direkt aus elektrischer Energie gewonnen werden, allerdings erzeugen Wind- und Solaranlagen Energie nicht bedarfsgerecht, sondern aufkommensabhängig. Zur Anpassung der Erzeugung an die Nachfrage sind neben Flexibilisierungsinstrumenten auf der Verbraucherseite, dem so genannten Demand Management, auch Verfahren erforderlich, die Energiemengen in der Größenordnung von Terawattstunden über längere Zeiträume speichern können. Dies ist nur über die Umwandlung elektrischer Energie in chemische Energieträger möglich – die Power-to-Gas-Technologie (PtG) ist die wesentliche Brücke zwischen der Erzeugung erneuerbarer Energie in Wind- und Solaranlagen und deren umfassender Nutzung im Energiesystem. Dabei wird elektrische Energie mithilfe der Elektrolyse in Wasserstoff umgewandelt. Aus diesem können bei Bedarf durch nachfolgende Synthese beispielsweise auch Methan oder flüssige Energieträger beziehungsweise Chemikalien erzeugt werden. Jährlich über 20 Millionen Tonnen Kohlendioxid
Jenseits rein energetischer Anwendungen ist so auch die Bereitstellung grüner industrieller Rohstoffe möglich. Wasserstoff wird beispielsweise in der chemischen, petrochemischen und metallverarbeitenden Industrie eingesetzt. Der heute in der deutschen Industrie genutzte Wasserstoff von circa 50 Millionen Normkubikmeter pro Tag wird größtenteils aus fossilen Quellen gewonnen (grauer Wasserstoff), vor allem aus Erdgas. Dabei werden jährlich über 20 Millionen Tonnen Kohlendioxid freigesetzt. Bei der Wasserstofferzeugung durch Elektrolyse mit Strom aus erneuerbaren Energien (grüner Wasserstoff) wird kein CO2 emittiert. Die mit der industriellen Wasserstoffnutzung verbundenen CO2-Emissionen können so durch zunehmende Substitution des heute verwendeten grauen Wasserstoffs entsprechend reduziert werden. Gleiches gilt für den Einsatz anderer synthetischer Grundstoffe, die aus grünem Wasserstoff erzeugt werden. Darüber hinaus kann er Erdgas in thermischen Anwendungen ersetzen. Und in der Stahlproduktion ist die Verwendung von grünem Wasserstoff zur Direktreduktion praktisch der einzige Weg zu deren Dekarbonisierung.
Anzahl und Größe nehmen zu
Die Ludwig-Bölkow-Systemtechnik führt seit Jahren eine Datenbank mit umfangreichen Informationen zu bestehenden und geplanten Power-to-Gas-Projekten auf der ganzen Welt. Bis Ende 2019 wurden weltweit mehr als 300 PtG-Projekte bekanntgegeben. Dabei kamen allein in der zweiten Jahreshälfte 2019 mehr angekündigte Kapazitäten dazu als in den sechs vorhergehenden Jahren zusammen. Mit der Anzahl der PtG-Anlagen steigt ebenfalls die Anlagengröße. Während auch in den Nachbarländern größere Anlagen geplant werden, war Deutschland im vergangenen Jahr Schwerpunkt der Entwicklungen.
Mehrere Elektrolyseure mit einer elektrischen Nennleistung größer als 30 Megawatt sollen in den kommenden Jahren in der Bundesrepublik errichtet werden. Wesentlicher Katalysator für diese Dynamik war das Energieforschungsprogramm der Bundesregierung für „Reallabore der Energiewende“. Darin sollen Wasserstofftechnologien unter realen Bedingungen und im industriellen Maßstab eingesetzt und erprobt werden. Zudem unterstützt der Bund im Rahmen des HyLand-Förderprogramms weitere Wasserstoffregionen in Deutschland. Im Dezember 2019 wurden 13 HyExpert-Regionen und drei HyPerformer-Verbundregionen für die Entwicklung von Wasserstoff- und Power-to-Gas-Projekten beziehungsweise deren Umsetzung in konkreten Regionalkonzepten ausgewählt.
Große deutsche Power-to-Gas-Projekte
Bei den Anwendungen steht die Sektorenkopplung im Fokus, welche die Strom-, Wärme- und Gasbranche sowie den Mobilitätssektor verbindet. Neben dem verbesserten Ausgleich zwischen erneuerbarer Energieerzeugung und der Energienachfrage liefern Anwendungen in der Mobilität wesentliche Impulse für die dringende Treibhausgasemissionsreduktion im Transportsektor – insbesondere in Anwendungen mit hohen Anforderungen.
Beispiele für große deutsche Power-to-Gas-Projekte sind hybridge von Open Grid Europe und Amprion sowie Element Eins von Gasunie, Thyssengas und TenneT. In den Projekten der Stromnetz- und Gasnetzbetreiber soll die Sektorenkopplung zwischen Gas- und Stromnetz im großen Maßstab erprobt werden. Darüber hinaus wird in der Shell Raffinerie in Wesseling eine Anlage für die Erzeugung von grünem Wasserstoff für die petrochemische Industrie aufgebaut.
Grüner Wasserstoff ist derzeit noch teurer als der aus fossilen Quellen erzeugte. Eine sukzessive Annäherung der Kosten wird aufgrund von drei wesentlichen Faktoren erwartet. Politische und regulatorische Rahmenbedingungen werden zunehmend angepasst, um Anreize für die Nutzung CO2-armer Technologien und Energieträger zu schaffen; CO2-Abgaben sind hierfür ein prominentes Beispiel. Die Kosten für erneuerbaren Strom fallen weiter kontinuierlich, sowohl in Deutschland als auch international. Und die Investitionskosten für Elektrolyseure werden mit zunehmender Skalierung der Anlagen ebenfalls deutlich sinken.
Dr. Uwe Albrecht
Dr. Albrecht, Uwe
Dr. Uwe Albrecht ist Geschäftsführer der Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH (LBST). Davor war er als Managing Partner bei Siemens Venture Capital sowie im Innovationsmanagement und in der Technologieberatung bei Siemens und Mannesmann tätig. Albrecht hat in Mainz und den USA Physik studiert und seine Promotion an der Universität Konstanz abgeschlossen.
Dr. Uwe Albrecht ist Geschäftsführer der Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH (LBST). Davor war er als Managing Partner bei Siemens Venture Capital sowie im Innovationsmanagement und in der Technologieberatung bei Siemens und Mannesmann tätig. Albrecht hat in Mainz und den USA Physik studiert und seine Promotion an der Universität Konstanz abgeschlossen.
http://www.lbst.de
Dieser Beitrag ist in der Ausgabe Mai/Juni 2020 von stadt+werk erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren. (Deep Link)
Stichwörter: Bioenergie, Wasserstoff, Erdgas, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH (LBST)
Bildquelle: Bölkow-Systemtechnik GmbH
Weitere Meldungen und Beiträge aus dem Bereich Bioenergie
Fachkongress Holzenergie: Klimanutzen von Holz
[23.9.2024] Auf dem 24. Fachkongress Holzenergie in Würzburg wurde die Bedeutung von Holz als erneuerbarer Wärmequelle diskutiert. Die Branche fordert klare politische Unterstützung, um die Energiewende voranzutreiben. mehr...
[23.9.2024] Auf dem 24. Fachkongress Holzenergie in Würzburg wurde die Bedeutung von Holz als erneuerbarer Wärmequelle diskutiert. Die Branche fordert klare politische Unterstützung, um die Energiewende voranzutreiben. mehr...
Landwärme-Insolvenz: Kommunikation „ungünstig“
[19.9.2024] Stadtwerke fürchten große Auswirkungen der Landwärme-Insolvenz. Das Kommunikationsverhalten des Unternehmens sei „ungünstig“, so der Branchenverband ASEW. mehr...
[19.9.2024] Stadtwerke fürchten große Auswirkungen der Landwärme-Insolvenz. Das Kommunikationsverhalten des Unternehmens sei „ungünstig“, so der Branchenverband ASEW. mehr...
Biomethan: Erster Online-Marktplatz gestartet
[17.9.2024] Green Navigation startet den ersten Online-Marktplatz für Biomethan. mehr...
[17.9.2024] Green Navigation startet den ersten Online-Marktplatz für Biomethan. mehr...
Studie: Potenzial von Biogasanlagen
[12.9.2024] Biogasanlagen könnten eine entscheidende Rolle bei der Sicherung der deutschen Stromversorgung spielen. Laut einer Studie der Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg-Erlangen können bis 2030 durch die Flexibilisierung bestehender Anlagen zwölf Gigawatt Leistung bereitgestellt werden. mehr...
[12.9.2024] Biogasanlagen könnten eine entscheidende Rolle bei der Sicherung der deutschen Stromversorgung spielen. Laut einer Studie der Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg-Erlangen können bis 2030 durch die Flexibilisierung bestehender Anlagen zwölf Gigawatt Leistung bereitgestellt werden. mehr...
Robin Wood: Keinerlei Schutz für Wälder
[4.9.2024] Die Berliner Nachhaltigkeitsvereinbarung für Biomasse garantiere keinerlei Schutz für Wälder und Natur, so der Naturschutzverband Robin Wood. mehr...
[4.9.2024] Die Berliner Nachhaltigkeitsvereinbarung für Biomasse garantiere keinerlei Schutz für Wälder und Natur, so der Naturschutzverband Robin Wood. mehr...