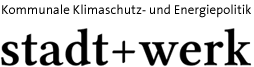Smart City:
Neues wagen
[4.3.2021] Im Dezember ist die dritte Staffel des Modellwettbewerbs Smart Cities gestartet. 300 Millionen Euro stehen aus dem Konjunkturprogramm für die Städte und ihren strategischen Umgang mit der Digitalisierung zur Verfügung. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 14. März 2021.
 Die Bundesregierung hat im Jahr 2016 die Dialogplattform Smart Cities ins Leben gerufen, die Kommunen bei Fragen der Digitalisierung in der Stadtentwicklung beratend zur Seite steht. Ein vom Bundesinnenministerium initiierter Modellwettbewerb Smart Cities geht gerade in die dritte Runde. An der ersten Staffel 2019 nahmen 13 Modellprojekte teil, darunter die Städte Solingen, Ulm, Cottbus und Grevesmühlen, aber auch interkommunale Kooperationen und Landkreise. Viele der Modellprojekte befassten sich zunächst mit der Erarbeitung einer Smart-City-Strategie: In welchen Themenfeldern der Stadtentwicklung können digitale Technologien gewinnbringend eingesetzt werden? Überall wurde ein Findungsprozess unter Beteiligung der Bürgergesellschaft durchgeführt. Die zweite Staffel 2020 förderte 32 Modellprojekte, etwa in Darmstadt, Jena und Köln, die sich mit konkreten Fragen nach verbessertem Energie-Management, intelligenter Mobilität oder smarter Vernetzung beschäftigten. In den Projektbeschreibungen ist oft prosaisch von „digitaler Heimat“, „vernetzter und blühender Stadt“ oder „Nachbarschaft in Echtzeit“ die Rede. Diese Tradition soll nun in der dritten Staffel fortgeführt werden. Sie bezieht sich auf die Zeit nach der Corona-Pandemie und ruft die Kommunen auf, „Neues zu wagen und die Chancen der Digitalisierung zu nutzen“. Die Modellprojekte sollen den strategischen Umgang mit den Möglichkeiten und Herausforderungen für die Stadtentwicklung durch Digitalisierung erforschen. Als Lernbeispiele sollen die gewonnenen Erkenntnisse später in die Breite getragen und allen Kommunen zugänglich gemacht werden. Diesbezüglich ist im aktuellen Aufruf ausdrücklich von Open-Source-Lösungen die Rede, die leichter zu übernehmen und nachzunutzen sind. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 14. März 2021.
Die Bundesregierung hat im Jahr 2016 die Dialogplattform Smart Cities ins Leben gerufen, die Kommunen bei Fragen der Digitalisierung in der Stadtentwicklung beratend zur Seite steht. Ein vom Bundesinnenministerium initiierter Modellwettbewerb Smart Cities geht gerade in die dritte Runde. An der ersten Staffel 2019 nahmen 13 Modellprojekte teil, darunter die Städte Solingen, Ulm, Cottbus und Grevesmühlen, aber auch interkommunale Kooperationen und Landkreise. Viele der Modellprojekte befassten sich zunächst mit der Erarbeitung einer Smart-City-Strategie: In welchen Themenfeldern der Stadtentwicklung können digitale Technologien gewinnbringend eingesetzt werden? Überall wurde ein Findungsprozess unter Beteiligung der Bürgergesellschaft durchgeführt. Die zweite Staffel 2020 förderte 32 Modellprojekte, etwa in Darmstadt, Jena und Köln, die sich mit konkreten Fragen nach verbessertem Energie-Management, intelligenter Mobilität oder smarter Vernetzung beschäftigten. In den Projektbeschreibungen ist oft prosaisch von „digitaler Heimat“, „vernetzter und blühender Stadt“ oder „Nachbarschaft in Echtzeit“ die Rede. Diese Tradition soll nun in der dritten Staffel fortgeführt werden. Sie bezieht sich auf die Zeit nach der Corona-Pandemie und ruft die Kommunen auf, „Neues zu wagen und die Chancen der Digitalisierung zu nutzen“. Die Modellprojekte sollen den strategischen Umgang mit den Möglichkeiten und Herausforderungen für die Stadtentwicklung durch Digitalisierung erforschen. Als Lernbeispiele sollen die gewonnenen Erkenntnisse später in die Breite getragen und allen Kommunen zugänglich gemacht werden. Diesbezüglich ist im aktuellen Aufruf ausdrücklich von Open-Source-Lösungen die Rede, die leichter zu übernehmen und nachzunutzen sind. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 14. März 2021.Kommunen kooperieren
Der Bund hat die drei Wettbewerbe insgesamt mit bislang 800 Millionen Euro gefördert. Einige Bundesländer haben darüber hinaus eigene Projekte aufgelegt, wie etwa Nordrhein-Westfalen mit den Digitalen Modellkommunen. Dabei zeigt sich: Die meisten geförderten Kommunen entscheiden sich für mehrere kleine Projekte, anstatt den gesamten Förderbetrag in ein Großprojekt zu investieren. Die Grenzen zur Verwaltungsdigitalisierung sind fließend. Beispiel Paderborn: Dort entschloss sich der Kreis zusammen mit den Städten Bielefeld und Delbrück für ein Online-Service-Bürgerportal, wo Urkunden beantragt, Hunde angemeldet und Eheschließungen annonciert werden können. Ganz so wie es auch das Onlinezugangsgesetz vorsieht. Ein anderes Paderborner Projekt ermittelt anhand einer intelligenten Ampelsteuerung, wie der Verkehr flüssiger und die Schadstoffemissionen sowie der Straßenlärm gesenkt werden können. Echtzeitdaten messen Staus, Stop and Go oder Wartezeiten und steuern die flexible Verkehrsführung. Zudem wird eine zentrale Open-Data-Plattform entwickelt, in der alle kommunalen Daten ämterübergreifend gebündelt werden sollen – Baudaten, Sensordaten zur Pegelstandsmessung des örtlichen Flusses Pader und digitalisierte Bilder können dann beispielsweise Einsatzkräften bei der zivilen Gefahrenabwehr zur Verfügung gestellt werden.
Ein weiteres Beispiel für Kooperationen sind die fünf Smart Cities in Südwestfalen: Arnsberg, Bad Berleburg, Menden, Olpe und Soest, die sich über den Projektverlauf bis 2026 zu einem Konsortium zusammengeschlossen haben und eine Rahmenstrategie für die Region entwickeln. „Die Vision für unsere Smart City von morgen ist, dass wir uns digital vernetzt fortbewegen, wir eine Stadt sowohl per Smartphone als auch als Passantin erleben können, dass Beteiligung und Mitbestimmung von zu Hause aus möglich ist, wir uns der CO2-Neutralität annähern und noch ganz viel mehr“, heißt es in einem Projektvideo.
Daten sollten dem Gemeinwohl dienen
In Wolfsburg ist eine Smart-City-App in der Entwicklung, die den Kontakt zwischen Bürgern und Verwaltung herstellt und auf der Basis anonymisierter Daten bestimmte stadtbezogene Dienste zu Mobilität, Freizeitgestaltung und ÖPNV ermöglicht. Eine Bezahlfunktion ist ebenfalls vorgesehen. Wolfsburg arbeitet in dieser Hinsicht sowohl mit städtischen Unternehmen wie den Stadtwerken und einem regionalen Telekommunikationsanbieter zusammen als auch mit anderen Kommunen. Interesse an der Zusammenarbeit haben etwa Solingen und Remscheid angemeldet.
Bei Smart Cities geht es um Daten. Was gegenwärtig in deutschen Kommunen an smarten Einzellösungen entsteht, bietet nur einen kleinen Vorgeschmack des Möglichen. In New York wird mit dem Projekt Hudson Yards an einer „neuen Nachbarschaft für die nächste Generation“ gebaut. Tausende Smart-Data-Sensoren zeichnen in dem Wohn-, Arbeits- und Konsumquartier die Bewegungen der Bewohner und Besucher auf. Globale Technologieunternehmen wittern einen Megamarkt für die Datenökonomie. Der Stadtforscher Robert Kaltenbrunner hat unlängst in einem Beitrag in der Berliner Zeitung eine auf individuellen Rechten basierende und gemeinwohlorientierte Ausrichtung smarter Städte gefordert. „Denn natürlich tragen digitale Steuerungen zu einem wesentlich effizienteren Betrieb städtischer Infrastrukturen bei. Werden die hier entstehenden Daten etwa mit anonymisierten Mobilfunkdaten und weiteren kommunalen Strukturdaten kombiniert, kann die Infrastrukturplanung beschleunigt und verfeinert werden“, so Kaltenbrunner. Doch müsse dafür gesorgt werden, dass die smarten Innovationen im Dienst von Gemeinwohl und Daseinsvorsorge verbleiben und nicht in den Datenbeständen der Tech-Giganten.
Tendenz zur allgemeinen Datenöffnung
Die Diskussion in Deutschland tendiert zu einer allgemeinen Öffnung der Daten. Im Entwurf des Zweiten Open-Data-Gesetzes und Datennutzungsgesetzes (DNG) spricht sich die Bundesregierung nicht nur für eine weitgehende Bereitstellungspflicht von Verwaltungsdaten aus, sondern will auch öffentliche Unternehmen und private Unternehmen bestimmter Bereiche der Daseinsvorsorge in das Open-Data-Konzept einbeziehen. Dies soll für Unternehmen des Verkehrswesens, der Wasserversorgung und für Energieunternehmen gelten. Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) hat in einer Stellungnahme die beabsichtigte Gleichbehandlung von öffentlichen und privaten Unternehmen bei der Datenherausgabe ausdrücklich begrüßt: „Wir brauchen gleiche Regeln für alle.“
Helmut Merschmann
https://www.smart-cities-made-in.de
https://www.smart-city-dialog.de
Dieser Beitrag ist in der Ausgabe März 2021 von Kommune21 erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren. (Deep Link)
Stichwörter: Smart City, Modellwettbewerb Smart Cities
Bildquelle: Dmitrii Kharchenko / 123rf.com
Weitere Meldungen und Beiträge aus dem Bereich Smart City
Würzburg: Erste 5G-Straßenleuchte Bayerns
[22.4.2024] In Würzburg wurde jetzt die erste 5G-Straßenleuchte Bayerns in Betrieb genommen. Sie ist das Ergebnis eines Pilotprojekts von O2 Telefónica, 5G Synergiewerk und den Stadtwerken Würzburg. mehr...
[22.4.2024] In Würzburg wurde jetzt die erste 5G-Straßenleuchte Bayerns in Betrieb genommen. Sie ist das Ergebnis eines Pilotprojekts von O2 Telefónica, 5G Synergiewerk und den Stadtwerken Würzburg. mehr...
Hagen: Erfassung des Energieverbrauchs
[11.4.2024] In der Stadt Hagen erfassen intelligente Messsysteme und Sensoren seit Anfang Februar den Energieverbrauch in städtischen Gebäuden. mehr...
[11.4.2024] In der Stadt Hagen erfassen intelligente Messsysteme und Sensoren seit Anfang Februar den Energieverbrauch in städtischen Gebäuden. mehr...
Konstanz: Wetterstationen für die Smart Green City
[22.12.2023] Zwölf Wetterstationen liefern in Konstanz künftig genaue Klimadaten. Diese sollen unter anderem für die Stadtplanung und zur effizienten Steuerung des Winterdienstes genutzt werden. mehr...
[22.12.2023] Zwölf Wetterstationen liefern in Konstanz künftig genaue Klimadaten. Diese sollen unter anderem für die Stadtplanung und zur effizienten Steuerung des Winterdienstes genutzt werden. mehr...
Mainova/evm: Kräfte gebündelt
[12.12.2023] Um Kommunen auf dem Weg zur Smart City zu unterstützen, arbeiten Mainova und die Energieversorgung Mittelrhein (evm) enger zusammen. Beide Unternehmen wollen ein gemeinsames Smart-City-Portfolio entwickeln. mehr...
[12.12.2023] Um Kommunen auf dem Weg zur Smart City zu unterstützen, arbeiten Mainova und die Energieversorgung Mittelrhein (evm) enger zusammen. Beide Unternehmen wollen ein gemeinsames Smart-City-Portfolio entwickeln. mehr...
energielenker: Regler steuert smartes Quartier
[15.11.2023] Ein Regler von energielenker steuert die Energieflüsse in einem smarten Quartier Harsefeld. mehr...
[15.11.2023] Ein Regler von energielenker steuert die Energieflüsse in einem smarten Quartier Harsefeld. mehr...